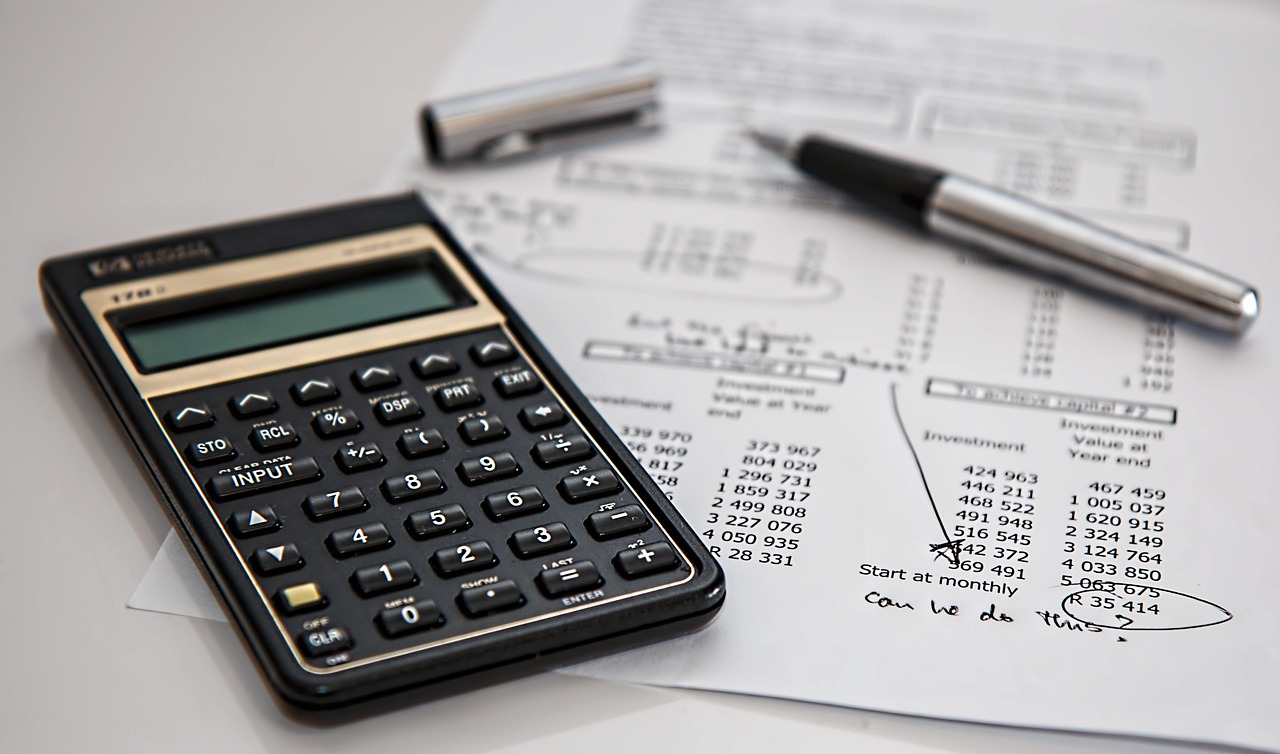
Kunst ist Leidenschaft – aber auch Künstlerinnen und Künstler kommen um das Thema Steuern nicht herum. Ob Maler, Musiker, Designer oder Schauspieler: Wer kreativ arbeitet und Geld verdient, sollte wissen, wie die steuerliche Seite funktioniert. Hier kommt ein einfacher Überblick.
Hinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine Steuerberatung. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich jederzeit ändern.
1. Selbstständig oder angestellt?
Zuerst musst du wissen, wie du arbeitest:
- Angestellte Künstler (z. B. im Theater oder Verlag) bekommen Lohn, von dem bereits Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden.
- Freischaffende Künstler (z. B. Illustrator:innen, Musiker:innen, Fotograf:innen) arbeiten selbstständig – sie müssen ihre Steuern selbst regeln.
2. Steuerarten, die für Künstler wichtig sind
Einkommensteuer
Sie fällt auf deinen Gewinn an (also Einnahmen minus Ausgaben).
Beispiel: Du verdienst 20.000 €, gibst 5.000 € für Materialien, Studio, Software usw. aus → dein Gewinn = 15.000 €.
Darauf zahlst du Einkommensteuer – je nach Höhe deines Einkommens.
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
- Der Regelsatz liegt bei 19 %.
- Viele Künstler nutzen aber die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG).
Wenn du unter 22.000 € Umsatz pro Jahr bleibst, musst du keine Umsatzsteuer ausweisen. - Achtung: Wer darauf verzichtet, kann auch keine Vorsteuer abziehen.
Künstlersozialkasse (KSK)
Die KSK ist für freischaffende Künstler Gold wert:
Sie übernimmt den Arbeitgeberanteil zu Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.
Dafür zahlst du selbst nur den Arbeitnehmeranteil – ähnlich wie Angestellte.
Anmeldung lohnt sich fast immer!
3. Wichtige Ausgaben, die du absetzen kannst
Alles, was du für deine künstlerische Tätigkeit brauchst, kannst du als Betriebsausgabe absetzen:
- Materialien, Instrumente, Software, Kamera, Laptop
- Atelier- oder Studiomiete
- Fahrtkosten, Reisekosten zu Ausstellungen oder Auftritten
- Website, Werbung, Portfolios
- Fachliteratur oder Weiterbildungen
Tipp: Belege immer aufbewahren – das Finanzamt will Nachweise!
4. Pflichten & Fristen
- Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) für Selbstständige
- Steuererklärung: meist bis 31. Juli des Folgejahres (mit Steuerberater verlängert bis Ende Februar des übernächsten Jahres)
- Umsatzsteuervoranmeldung, falls du keine Kleinunternehmerregelung nutzt
Fazit
Steuern sind kein Feind der Kreativität – sie lassen sich mit ein wenig Struktur gut bewältigen.
Wer seine Belege ordentlich führt, die KSK nutzt und die wichtigsten Fristen kennt, hat die Basis im Griff.
So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt: deine Kunst.
Welche Steuer-Arten sind für Künstler relevant?
Kreativ sein ist großartig – aber wer mit seiner Kunst Geld verdient, muss sich auch mit dem Thema Steuern auseinandersetzen. Ob Malerin, Musiker, Schauspielerin, Grafiker oder Autor: Wenn du selbstständig arbeitest, gibt es einige Steuerarten, die du kennen solltest.
Hier kommt der Überblick – verständlich erklärt.
1. Einkommensteuer
Die Einkommensteuer betrifft alle, die mit ihrer Kunst Geld verdienen.
Du zahlst sie auf deinen Gewinn, also:
Einnahmen – Ausgaben = Gewinn
Beispiel:
Du verdienst 25.000 €, gibst 5.000 € für Materialien, Studio und Werbung aus → dein Gewinn = 20.000 €.
Darauf zahlst du Einkommensteuer (je nach Einkommenshöhe und Freibeträgen).
Tipp: Viele Künstler reichen ihre Steuer über eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ein – das ist die einfache Form der Gewinnermittlung.
2. Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
Die Umsatzsteuer fällt an, wenn du selbstständig künstlerisch tätig bist und deine Werke oder Leistungen verkaufst.
- Der Regelsatz beträgt 19 %.
- Für einige künstlerische Leistungen (z. B. Eintrittskarten, bestimmte Aufführungen) gilt 7 %.
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG):
Wenn dein Umsatz im Jahr unter 22.000 € liegt, musst du keine Umsatzsteuer ausweisen – sparst also Bürokratie.
Aber: Du kannst dann auch keine Vorsteuer abziehen (z. B. für gekaufte Materialien oder Technik).
3. Gewerbesteuer – meist kein Thema
Viele Künstler üben eine freiberufliche Tätigkeit aus.
Das heißt: Keine Gewerbesteuer!
Nur wenn du zusätzlich gewerbliche Aktivitäten betreibst (z. B. Merchandise-Verkauf, Kunsthandel), kann Gewerbesteuer relevant werden.
4. Künstlersozialabgabe / Sozialversicherung
Zwar keine Steuer im klassischen Sinn, aber wichtig zu wissen:
Über die Künstlersozialkasse (KSK) können freischaffende Künstler in die gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung aufgenommen werden.
Die KSK übernimmt den „Arbeitgeberanteil“ – du zahlst also nur etwa die Hälfte selbst.
Das spart bares Geld und ist ein echter Vorteil für Selbstständige im Kunstbereich.
5. Weitere mögliche Abgaben
- Ausländische Einkünfte: Wenn du international arbeitest (z. B. Ausstellungen, Auftritte, Streaming), können Doppelbesteuerungsabkommen wichtig werden.
- Verwertungsgesellschaften (z. B. VG Bild-Kunst, GEMA): Einnahmen von dort sind steuerpflichtig, müssen also ebenfalls angegeben werden.
Fazit
Für Künstler sind vor allem Einkommensteuer, Umsatzsteuer und (indirekt) die Künstlersozialversicherung relevant.
Wer frühzeitig Ordnung in seine Finanzen bringt, Belege sammelt und sich über Freibeträge informiert, kann seine kreative Freiheit behalten – ganz ohne Steuerstress.
Müssen Künstler Gewerbesteuer zahlen?
Viele Künstlerinnen und Künstler fragen sich irgendwann: „Brauche ich eigentlich ein Gewerbe?“ oder „Muss ich Gewerbesteuer zahlen?“
Die gute Nachricht vorweg: In den meisten Fällen – nein!
Aber es gibt Ausnahmen. Hier erfährst du, wann und warum.
1. Künstler gelten in der Regel als Freiberufler
Die meisten künstlerischen Tätigkeiten zählen laut Einkommensteuergesetz zu den freien Berufen.
Das bedeutet:
- Du bist kein Gewerbetreibender,
- Du musst kein Gewerbe anmelden,
- und du zahlst keine Gewerbesteuer.
Beispiele für freiberufliche Künstler:
- Schauspieler, Musiker, Tänzer
- Maler, Bildhauer, Illustrator:innen
- Fotograf:innen mit künstlerischem Anspruch
- Schriftsteller:innen, Texter, Komponisten
Solange du eigenständig schöpferisch tätig bist, giltst du als freier Künstler.
2. Wann wird es gewerblich?
Nicht jede Tätigkeit im Kunstbereich ist automatisch freiberuflich.
Gewerbesteuer kann anfallen, wenn du:
- reine Handelsgeschäfte betreibst (z. B. Kauf und Weiterverkauf von Kunstwerken anderer),
- Merchandise, Drucke oder Massenware verkaufst,
- oder Dienstleistungen anbietest, die keinen künstlerischen Charakter mehr haben (z. B. Produktfotografie, Design ohne eigene schöpferische Leistung).
Dann gilt deine Tätigkeit als gewerblich, und du musst ein Gewerbe anmelden.
Tipp: Wenn du sowohl künstlerische als auch gewerbliche Tätigkeiten hast, kann das Finanzamt sie trennen – oder, wenn sie eng verbunden sind, alles als gewerblich einstufen. Hier lohnt sich Beratung durch einen Steuerexperten!
3. Wann Gewerbesteuer tatsächlich gezahlt wird
Selbst wenn du gewerblich tätig bist, fällt Gewerbesteuer erst ab einem Gewinn von 24.500 € pro Jahr an.
Darunter bleibst du steuerfrei.
Und: Die gezahlte Gewerbesteuer wird teilweise auf die Einkommensteuer angerechnet, sodass die Belastung oft geringer ausfällt, als viele denken.
Fazit
Die meisten Künstler*innen sind freiberuflich tätig – und zahlen keine Gewerbesteuer.
Nur wer zusätzlich gewerbliche Aktivitäten betreibt (z. B. Handel, Merchandise oder Auftragsarbeiten ohne künstlerischen Anteil), kann gewerbesteuerpflichtig werden.
Wer unsicher ist, sollte sein Tätigkeitsprofil kurz vom Finanzamt oder Steuerberater prüfen lassen – das spart später Ärger und unnötige Steuern.
Wie viel Gewerbesteuer zahlt man bei 50.000 € Gewinn und einem Hebesatz von 300 %?
Wer ein Gewerbe betreibt – egal ob Handwerker, Designer oder Händler – muss auf den Gewinn Gewerbesteuer zahlen.
Wie hoch diese Steuer ausfällt, hängt nicht nur vom Gewinn, sondern auch vom Hebesatz deiner Stadt oder Gemeinde ab.
Hier erfährst du, wie man sie berechnet – Schritt für Schritt und mit Beispiel.
1. Freibetrag: 24.500 €
Für Einzelunternehmer und Personengesellschaften gilt ein Freibetrag von 24.500 €.
Das heißt:
Nur der Gewinn, der darüber liegt, wird mit Gewerbesteuer belegt.
Beispiel:
Gewinn: 50.000 €
Freibetrag: 24.500 €
→ zu versteuernder Betrag: 25.500 €
2. Steuermessbetrag: 3,5 %
Auf diesen zu versteuernden Betrag wird der sogenannte Steuermessbetrag angewendet:
25.500 € × 3,5 % = 892,50 €
3. Hebesatz deiner Gemeinde
Jede Stadt legt ihren Hebesatz individuell fest – meist zwischen 200 % und 900 %.
Im Beispiel beträgt er 300 % (also das Dreifache des Steuermessbetrags).
892,50 € × 300 % = 2.677,50 €
4. Ergebnis:
Bei einem Gewerbegewinn von 50.000 € und einem Hebesatz von 300 % zahlst du etwa:
2.677,50 € Gewerbesteuer
5. Wichtiger Hinweis für Einzelunternehmer
Ein Teil der Gewerbesteuer wird auf die Einkommensteuer angerechnet (bis zu dem Faktor 3,8 × Steuermessbetrag).
Das bedeutet: Die tatsächliche Belastung fällt oft geringer aus, als sie auf den ersten Blick aussieht.
Fazit
Bei einem Gewinn von 50.000 € und einem Hebesatz von 300 % beträgt die Gewerbesteuer rund 2.678 € – dank Freibetrag und Anrechnung bleibt die Steuerlast für viele Einzelunternehmer aber überschaubar.
Tipp: Der Hebesatz unterscheidet sich stark je nach Ort – ein Blick in die Gemeindetabelle kann sich also lohnen!
Warum sind Steuerthemen für Kreative so schwer?
Kreative Menschen sprühen vor Ideen – aber wenn es um Steuern geht, fühlt sich das Ganze plötzlich an wie ein grauer Nebel aus Formularen, Paragrafen und Zahlen.
Warum ist das so? Und wie lässt sich der Knoten im Kopf lösen?
1. Kreativität und Bürokratie – zwei Welten prallen aufeinander
Künstlerinnen und Künstler denken intuitiv, visuell und emotional – das Finanzamt denkt strukturiert, logisch und formal.
Was für Buchhalter selbstverständlich ist, wirkt für Kreative oft wie eine andere Sprache:
- Was ist Betriebsausgabe?
- Muss ich Umsatzsteuer ausweisen?
- Bin ich freiberuflich oder gewerblich?
Das alles passt nicht zu der freien, intuitiven Denkweise, die Kreativität braucht.
2. Zu viele Regeln, zu wenig Klarheit
Das Steuerrecht ist kompliziert – und gerade bei Künstlern oft nicht eindeutig.
Ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist, hängt von feinen Unterschieden ab.
Selbst die Finanzämter bewerten ähnliche Fälle manchmal unterschiedlich.
Kein Wunder also, dass viele den Überblick verlieren oder Angst vor Fehlern haben.
3. Verwaltung frisst Zeit und Energie
Belege sammeln, Rechnungen schreiben, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Künstlersozialkasse …
Für viele Kreative bedeutet das: Weniger Zeit für das, was sie lieben.
Der administrative Aufwand fühlt sich oft an wie ein Berg, der ständig wächst.
4. Fehlende Unterstützung
In der Schule lernt man viel – aber nicht, wie man eine Steuererklärung macht.
Viele Künstler starten in die Selbstständigkeit ohne Grundwissen, ohne Mentor und mit jeder Menge Fragen.
Das führt schnell zu Unsicherheit oder Frust – dabei wäre etwas Aufklärung oft schon die halbe Miete.
5. Es geht auch anders
Zum Glück gibt es heute viele Wege, den Steuer-Dschungel zu lichten:
- Künstlerfreundliche Steuerberater, die auf kreative Berufe spezialisiert sind
- Workshops & Online-Kurse, die Steuern verständlich erklären
- Digitale Tools, die Buchhaltung und Belege vereinfachen
Denn wer seine Zahlen versteht, gewinnt Freiheit – auch kreativ.
Fazit
Steuern sind für Kreative schwer, weil sie komplex, unübersichtlich und emotionslos wirken – das genaue Gegenteil von Kunst.
Aber: Mit etwas Wissen, den richtigen Hilfsmitteln und ein bisschen Struktur wird aus Steuerstress schnell Steuersouveränität.
Und das Schönste daran: Wer Ordnung in seine Finanzen bringt, schafft mehr Raum für das, was wirklich zählt – die eigene Kreativität.